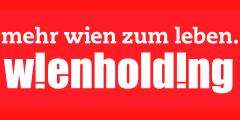Wien Holding News
Das Leben als geographische Fuge
Ernst Toch zählte zu den meistgespielten neuen Komponisten der neuen Sachlichkeit, wurde gefeiert, musste in den 30er Jahren emigrieren und war in den USA äußerst erfolgreich. Das Jüdische Museum, ein Unternehmen der Wien Holding, zeichnet in einer bemerkenswerten Ausstellung ein Porträt von Ernst Toch. Zu sehen ab 23.6. bis 31.10.2010 im PalaisEskeles.
Eine Wiederentdeckung
Die Ausstellung zeichnet ein Porträt des Modernisten Tochs, der 1887 in einer durchaus unmusikalischen Familie in der Leopoldstadt, dem jüdischen Wohnviertel Wiens, zur Welt kam. Sein Weg und Ruhm in Deutschland (Frankfurt, Mannheim, Berlin) bis 1932, sein schwieriges Exil in den USA (Komponist ohne Copyrightvertretung, Studiosystem Hollywood) und seine restlosen letzten Jahre zwischen den USA und Europa, in denen er die Form der Symphonie für sich neu entdeckt, stehen im Mittelpunkt der Schau.
Erzähltechnisch entwickelt sich die Ausstellung sowohl als Entdeckungsreise in die musikalische Welt des Komponisten der "Fuge aus der Geographie" als auch als Versuch, das 20. Jahrhundert aus der Perspektive eines modernen musikalischen Kosmopoliten zu begreifen.
Erzähltechnisch entwickelt sich die Ausstellung sowohl als Entdeckungsreise in die musikalische Welt des Komponisten der "Fuge aus der Geographie" als auch als Versuch, das 20. Jahrhundert aus der Perspektive eines modernen musikalischen Kosmopoliten zu begreifen.
Zur Biographie Ernst Tochs:
Toch kam 1887 in Wien zur Welt und starb 1964 in Los Angeles. Als Musiker Autodidakt, studierte er in Wien Philosophie und Medizin und ging bereits im Jahre 1909 nach Deutschland. 1921 promovierte er in Heidelberg mit Beiträgen zur Stilkunde der Melodie. In den zwanziger Jahren – sie waren die erfolgreichste Phase in Tochs Leben – stand der Komponist beim Musikverlag Schott und Söhne unter Vertrag. 1922 stand er regelmäßig bei den Donaueschinger Musiktagen auf dem Programm, generell gab es in der Zwischenkriegszeit kaum ein Musikfestival der Gegenwart ohne Aufführung von Tochs Werken.
Keiner Stilrichtung zuordenbar, schuf er eine neue Art der Polyphonie wie z.B. beim Sprechchor Fuge aus der Geographie. In Amerika wurde er durch Konzerte von Erich Kleiber und Serge Koussevitzky und 1932 durch eine Tournee als Pianist mit der Boston Symphony Orchestra bekannt.
1933 begann in Florenz sein Weg ins Exil über Paris nach London, wo er Filmmusik komponierte. In New York war er ebenso wie Hanns Eisler Professor an der New School of Social Research bevor er nach Kalifornien übersiedelte, wo er weiterhin Filmmusik komponierte und an der University of Southern California unterrichtete. Seine Gastvorträge an der Universität Harvard wurden als The Shaping Forces in Music 1948 veröffentlicht.
Seine Besinnung auf österreichische Traditionen reflektieren seine sieben Sinfonien. Ebenso sind seine familiären Beziehungen sowie Briefe und Bekanntschaften durch eine innerliche und merkwürdig enge Verbundenheit an seine alte Heimat gekennzeichnet. Doch 1945 und auch in den Jahren danach bot ihm Österreich, ebenso wenig wie Korngold, Zeisl, Krenek, Eisler und vielen anderen Musik- und Kulturschaffenden, keine Rückkehrmöglichkeit.
Keiner Stilrichtung zuordenbar, schuf er eine neue Art der Polyphonie wie z.B. beim Sprechchor Fuge aus der Geographie. In Amerika wurde er durch Konzerte von Erich Kleiber und Serge Koussevitzky und 1932 durch eine Tournee als Pianist mit der Boston Symphony Orchestra bekannt.
1933 begann in Florenz sein Weg ins Exil über Paris nach London, wo er Filmmusik komponierte. In New York war er ebenso wie Hanns Eisler Professor an der New School of Social Research bevor er nach Kalifornien übersiedelte, wo er weiterhin Filmmusik komponierte und an der University of Southern California unterrichtete. Seine Gastvorträge an der Universität Harvard wurden als The Shaping Forces in Music 1948 veröffentlicht.
Seine Besinnung auf österreichische Traditionen reflektieren seine sieben Sinfonien. Ebenso sind seine familiären Beziehungen sowie Briefe und Bekanntschaften durch eine innerliche und merkwürdig enge Verbundenheit an seine alte Heimat gekennzeichnet. Doch 1945 und auch in den Jahren danach bot ihm Österreich, ebenso wenig wie Korngold, Zeisl, Krenek, Eisler und vielen anderen Musik- und Kulturschaffenden, keine Rückkehrmöglichkeit.
23.06.2010 - 31.10.2010
Palais Eskeles
Dorotheergasse 11
1010 Wien
Palais Eskeles
Dorotheergasse 11
1010 Wien