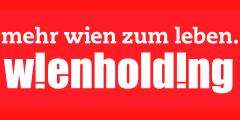Wien Holding News
Jüdisches Museum Wien: "Musik des Aufbruchs":
Nach dem großen Erfolg der Musikausstellung "Quasi una Fantasia", die im vergangenen Jahr anlässlich der Wiener Festwochen im Jüdischen Museum Wien gezeigt wurde – die Ausstellung ist ab 7. Ferbuar in New York zu sehen – präsentiert das Museum von 25. Februar bis 2. Mai 2004 die Dokumentation "Continental Britons: Hans Gál und Egon Wellesz" als erste einer Reihe von Musikausstellungen die unter dem gemeinsamen Obertitel "Musik des Aufbruchs" in den nächsten beiden Jahren gezeigt werden wird. Ausgangspunkt dafür ist die Aufarbeitung der jüngeren Musikgeschichte Wiens, die geprägt ist von einem "Widerstand gegen die Moderne":
Es ist bezeichnend, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg 22 Jahre dauerte, bis es zur Aufführung sämtlicher Symphonien Gustav Mahlers kam. Die Auseinandersetzung mit der Wiener Moderne in der Musik war aber international schon so weit gediehen, dass der Widerstand der Wiener Musikinstitutionen und des Wiener Musikpublikums den Durchbruch nicht mehr weiter verhindern konnten: Gustav Mahler hat sich durchgesetzt und seit den Auftritten Leonard Bernsteins in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts kann man sogar von einer "Wiener Mahler-Tradition" sprechen, durch deren Sogkraft nun auch die verschütteten Schätze der von den Nationalsozialisten als "entartet" verfolgten und verbannten, auch einiger ermordeten Musiker entdeckt werden können. Das Jüdische Museum Wien beginnt daher in Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen eine Serie von Ausstellungen und Begleitveranstaltungen, die eine Begegnung und Auseinadersetzung mit den wichtigsten und interessantesten Komponisten ermöglicht.
"Continental Britons: Hans Gál und Egon Wellesz" ist die erste Ausstellung dieser Reihe. Die Wiener Komponisten Hans Gál (1890-1987) und Egon Wellesz (1885-1974) gehörten in der Zwischenkriegszeit zu den Stars der deutschsprachigen Musikszene. Ihre Werke wurden in allen bedeutenden Konzertsälen und Opernbühnen Österreichs und Deutschlands gespielt.
Nach ihrer Vertreibung aus Wien 1938 flüchteten beide nach Großbritannien, wo sie nach Kriegsbeginn als "enemy aliens" (feindliche Ausländer) interniert wurden. Sie blieben in ihrer neuen Heimat, wurden dort an Universitäten berufen und komponierten bis ins hohe Alter. An ihrem Beispiel lässt sich die ganze Vielfalt der Musikstadt Wien erfassen – aber auch ihre Verluste als Folgen von Krieg und Antisemitismus aufzeigen. Denn Gál und Wellesz wurden im Österreich der Nachkriegszeit zwar mit hohen Auszeichnungen bedacht, doch ihre Musik wurde kaum gespielt: Gerade in der Musikszene konnten sich viele Größen der Nazi-Zeit unbeschadet in die Zeit nach 1945 retten.
Gemeinsames und Trennendes in Leben und Werk von Hans Gál und Egon Wellesz
Mit Hans Gál und Egon Wellesz werden hier zwei Musiker porträtiert, die zumindest biografisch einiges gemeinsam haben: Ihre Namen verraten die Herkunft aus dem ungarischen Teil der Donaumonarchie, beide studierten bei Guido Adler am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien und unterrichten später selber dort. Ihre Kompositionen fanden ihren Weg von Wien nach Berlin und in andere deutsche Städte.
Beide arbeiteten mit namhaften Autoren zusammen: Wellesz mit Hugo von Hofmannsthal, Jakob Wassermann und Béla Balász, Gál mit Karl Michael Freiherr von Levetzow und Ödön von Horváth. Selbstverständlich wurden ihre Werke auch von den berühmtesten Dirigenten ihrer Zeit aufgeführt, darunter Clemens Krauss, Fritz Busch, Georg Szell, Josef Krips oder Wilhelm Furtwängler.
Während Wellesz 1917 aus der Israelitischen Kultusgemeinde austrat und ein überzeugter Katholik wurde, kann Gál als Agnostiker bezeichnet werden. 1938 flüchteten sie auf unterschiedlichen Wegen nach Großbritannien, doch während Wellesz durch eine Berufung an die Universität Oxford das Exil ohne größere materielle Probleme überwand, musste sich Gál mit seiner Familie lange Zeit als Hausmeister und mit kleinen Konzerten durchschlagen. Erst nach dem Krieg wurde er an die Universität Edinburgh berufen. Andererseits beteiligte sich Gál, der politisch der Sozialdemokratie nahe stand, überaus aktiv in der Szene österreichischer und deutscher Exil-Musiker und bildete sozusagen ihren musikalischen Außenpost in Schottland.
Wellesz stand schon aufgrund seiner politischen Einstellung als Monarchist und Anhänger des Ständestaates am Rande der eher links-orientierten Exilszene rund um das Free Austrian Movement und des Austrian Centre’s in London. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen politischen Haltung wurden beide 1940 für einige Monate wie tausende andere Flüchtlinge aus Österreich, Deutschland und Italien von den britischen Behörden auf der Isle of Man interniert. Dies erlebten sie als große Demütigung, da sie selbst von den Nazis verfolgt wurden und als Flüchtlinge ins Land gekommen waren.
Beide erhielten nach anfänglichen Widerständen offizielle Ehrungen in Österreich. Zwar wurde Gál unmittelbar nach dem Krieg eine Stellung in Wien angeboten, doch er hat sie aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Wellesz hingegen wäre sehr gerne zu seiner Professur an der Universität Wien zurück gekehrt, doch die war von Erich Schenk besetzt. Dieser war nach 1938 wesentlich an der "Arisierung" der Bibliothek von Guido Adler beteiligt. Wellesz andererseits hatte sich 1947 bemüht, seine "arisierte" Josef Hoffmann-Villa am Kaasgraben 38 restituiert zu erhalten – doch das Gericht anerkannte den Sachbestand des "Zwangsverkaufes" nicht.
Gál und Wellesz repräsentieren gleichzeitig zwei völlig unterschiedliche Musik-Sprachen: Gál hat im Rahmen der traditionellen Tonsprache stets neue Ausdrucksmöglichkeiten gesehen und hat innerhalb dieses Rahmens große Freiheit gefunden. Der Zweiten Wiener Schule stand er eher skeptisch gegenüber, da er in ihr ein entstelltes Verhältnis zwischen Komponist und Publikum, wie auch zwischen Einfall und Ausdruckmittel sah. Wellesz stand als Komponist in engem Kontakt zu Alban Berg und Anton Webern und später in einer gewissen Distanz zu Arnold Schoenberg und bildete somit einen integralen Bestandteil der Zweiten Wiener Schule. Seine Musik schwebt zwischen dem Romantisch-Kantigen und dem Homofonisch-Zeremoniellen. Gleichzeitig war er ein international renommierter Musikwissenschaftler, dessen bleibendes Verdienst die Entschlüsselung der byzantinischen Notenschrift ist.
In der Ausstellung werden neben Partituren, Handschriften und persönlichen Dokumente auch zahlreiche Fotografien historischer Aufführungen gezeigt. Die Objekte kommen großteils aus dem in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrten Egon Wellesz-Fond und aus dem erstmals erschlossenen Nachlass von Hans Gál, der sich in Privatbesitz befindet. Musikbeispiele und Ausschnitte aus Interviews werden über einen Audio-Guide eingespielt. Zusammengestellt wurde die Ausstellung vom Musikkurator des Jüdischen Museums Michael Haas in Zusammenarbeit mit dem Hauskurator Dr. Marcus G. Patka, die Gestaltung kommt von Thomas Geisler mit cp architektur. Parallel zur Ausstellung erscheint zum Preis von 24,90 € im Mandelbaum Verlag (ISBN 3-85 476-116-3) ein reich illustriertes Buch, das zwei CDs mit Musik von Hans Gál und Egon Wellesz enthält.
"Continental Britons: Hans Gál und Egon Wellesz" ist von 25. Februar bis 2. Mai 2004 im Jüdischen Museum zu sehen. Das Jüdische Museum Wien (A-1010 Wien, Dorotheergasse 11) ist Sonntag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, an Donnerstagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt: EUR 5/EUR 2,90 ermäßigt. Schulklassen in Begleitung eines Lehrers haben freien Eintritt und eine kostenlose Führung. Detailinformationen im Internet unter http://www.jmw.at/ .
Biografisches
Hans Gál (5.8.1890 Brunn am Gebirge – 3.10.1987 Edinburgh): Komponist, Musikwissenschaftler, Dirigent, Konzertmusiker und Pädagoge, stand als Schüler von Eusebius Mandyczewski und Guido Adler abseits der Schoenberg-Schule und komponierte als kontinuierliche Fortsetzung der Wiener Tradition von Mozart, Beethoven und vor allem Brahms, dessen Gesamtwerk er zusammen mit Mandyczewski herausgab. Er entwickelte eine originelle eigene Musiksprache, wurde von renommierten Dirigenten wie z.B. Wilhelm Furtwängler, Richard Strauss und Fritz Busch überaus geschätzt und genoss große Popularität beim breiten Publikum.
1933 wurden alle seine Werke in Deutschland verboten und er verlor seine Stellung als Direktor des Mainzer Konservatoriums. Nach Wien zurück gekehrt, musste er sich in Wien als Musiker, Pädagoge und Schriftsteller über Wasser halten. Nach dem "Anschluss" 1938 flüchtete er mit seiner Familie nach Großbritannien, wo er 1940 einige Monate auf der Isle auf Man interniert wurde. Nach seiner krankheitsbedingten Entlassung siedelte er sich in Edinburgh an und wirkte aktiv in der deutschsprachigen Exil-Szene mit. Nach dem Krieg blieb er in seiner neuen Heimat und war als Professor an der renommierten Edinburgh University überaus geschätzt.
Er wirkte bei der Begründung des Edinburgh Festivals mit und setzte seine Komponistenlaufbahn mit vielen weiteren Werken fort. In den sechziger und siebziger Jahren fand er größte Anerkennung als Verfasser von Monografien über Komponisten wie Brahms, Verdi und Schubert.
Egon Wellesz (21.10.1885 Wien – 9.11.1974 Oxford): Komponist, Byzantinist, Universitätsprofessor, gilt als eine der vielseitigsten Musikpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Als Schoenberg-Schüler erlebte er zusammen mit Alban Berg und Anton Webern die Anfänge der sogenannten Zweiten Wiener Schule, ging jedoch nach kurzer Zeit auf Rat Bruno Walters "seinen eigenen Weg". Als Schüler von Guido Adler am Institut für Musikwissenschaft entwickelte er sich zum international anerkannten Experten für die Barockoper, deren prägnante Eigenschaften er in seinen eigenen Bühnenwerken verwendete. Er hat mit den wichtigsten bahnbrechenden Choreografen und Regisseuren gearbeitet, als einzigem neben Richard Strauss hat Hugo von Hofmannsthal ihm Libretti und Balletthandlungen geliefert.
In der Musikwissenschaft war sein Ruhm ebenso groß wie im Musiktheater. Er entzifferte die byzantinische Notenschrift und gründete zusammen mit Kollegen aus England und Dänemark die "Monumenta Musicae Byzantinae". Die "Machtergreifung" 1933 verhinderte die deutschen Premieren seiner an der Wiener Staatsoper unter Clemens Krauss erfolgreichen Oper "Die Bakchantinnen" in München und Berlin. Die Emigration nach Großbritannien brachte ihm 1938 im 52. Lebensjahr eine Lehrstelle an der Oxford University, wo er noch 15 Jahre Musikwissenschaft und Tonsatz unterrichtete.
Nach dem Krieg wäre er gerne nach Wien zurück gekehrt, doch es wurde ihm keine Stellung angeboten. Bis 1972 komponierte er u.a. neun groß angelegte Sinfonien, die ersten tief in der Welt Bruckners und Mahlers verwurzelt, die späteren jedoch in kantiger Atonalität. Ein Schlaganfall 1972 bedeutete das Ende seines kreativen Geistes.