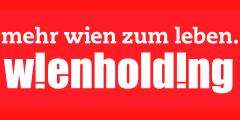Wien Holding News
Wien, Stadt der Juden - Die Welt der Tante Jolesch
"Das Wiener Judentum ... ist ein Stück von Wien", schrieb der Kulturhistoriker Hans Tietze 1933: "Es hat teil an aller Problematik des Wienerischen, mit dessen Saft sich der seine so lange vermischt hat." In der Zeit der Ersten Republik (1918 – 1938) lebten mehr als 200.000 Juden in Wien (knapp 11 Prozent der Gesamtbevölkerung). Es war nach Warschau die größte jüdische Gemeinde Europas und sie bildete ein bedeutendes Segment der Bevölkerung. Sie nahm an allen Aspekten des öffentlichen Lebens teil und prägte sie auch häufig. Keineswegs eine homogene Gruppe, waren die Wiener Juden ebenso in soziale und politische Gruppierungen zersplittert wie die restliche Bevölkerung.
In der Ausstellung wird das breit gefächerte Spektrum des Wiener Judentums zur Zeit seiner letzten Blüte in 21 Stationen vorgestellt. So entsteht ein Panoramabild, das von den Elendsquartieren der strenggläubigen Stetl-Juden, die aus Galizien geflohen waren, über die Cafés der Bohemiens und die Versammlungssäle der geistigen Elite bis in die Büros der Stadtverwaltung des Roten Wien und in die Salons des aufgeklärten Bürgertums reicht.
Jede der 21 Stationen wird von einem Meilenstein markiert, einem signifikanten Ereignis, um das herum das thematische Feld ausgelotet wird (z.B.: die Eröffnung des Kindergartens Goethehof für die pädagogischen Reformbestrebungen der Epoche oder die Gründung des Zsolnay-Verlages für das literarische Leben).
Wesentlicher Aspekt der Ausstellung ist es, die Geschichte des Wiener Judentums aus der Perspektive dieser Epoche zu erzählen, einer Zeit, die, noch bevor sich der Todesschatten der Schoa über die Stadt legte, von einer Auf- und Umbruchstimmung beflügelt war, in der utopische Gedanken wucherten, um die Reform von Kultur und Gesellschaft gerungen wurde und Juden wie Nichtjuden in einem brodelnden sozialen Klima um die Anerkennung ihrer jeweiligen Rollen kämpften.
"Wien, Stadt der Juden – Die Welt der Tante Jolesch" wird vom Jüdischen Museum Wien in Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen von 19. Mai bis 31. Oktober 2004 im Jüdischen Museum der Stadt Wien gezeigt. Die Ausstellung wurde von Joachim Riedl kuratiert und von Gustav Pichelmann gestaltet. Das Museum (A-1010 Wien, Dorotheergasse 11) ist Sonntag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, an Donnerstagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt: EURO 5/EURO 2,90 ermäßigt. Schulklassen in Begleitung eines Lehrers haben freien Eintritt und eine kostenlose Führung. Detailinformationen im Internet unter http://www.jmw.at/
Jüdisches Museum der Stadt Wien GmbH.,
Trattnerhof 2/106, A-1010 Wien
Tel: +43/1/5353 04 31
Fax: +43/1/535 04 24
Web: http://www.jmw.at/
Mail:jmw@info.at
Museum: Palais Eskeles, Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Hintergrundinformation zur Ausstellung
Die Ausstellung wird auf beiden Ausstellungsebenen des Museums gezeigt und setzt sich mit der Zeit der Ersten Republik auseinander, in der das Wiener Judentum seine letzte Blütezeit erlebte. Es hat sich retrospektiv die Betrachtungsweise eingebürgert, die Zeit der Ersten Republik als eine perspektivlose Zeitspanne anzusehen, eine Epoche, die ihrem Untergang bereits geweiht war, bevor sie überhaupt noch richtig begonnen hatte.
Dies ist eine gänzlich ahistorische Sicht, die einem historischen Determinismus huldigt, der einzig dazu dient, jene nachträglich noch aus der Verantwortung nehmen zu können, die 1934 das Schlittern in die Katastrophe und 1938 den Abstieg in die Barbarei zu verantworten hatten. Die Verantwortlichen waren keineswegs Getriebene, die nicht anders handeln konnten, sondern Gesinnungstäter, die eine Absicht verfolgten. Dass sie scheiterten, erlaubt nicht den Trugschluss, die Epoche insgesamt hätte keine Wahl erlaubt. Es gab sie und sie wurde mit den bekannten Konsequenzen getroffen.
Mit dem Jahr 1918 war nicht nur die imperiale Selbstherrlichkeit der kaiserlichen Residenzstadt Wien zusammengebrochen, es waren auch die allseits akzeptierten Grundregeln in Staat und Gesellschaft neu zu definieren. Diese Transformation von der Kaiserstadt zur Hauptstadt der Republik fand in erstaunlich kurzer Zeit statt. Wien verwandelte sich – wohl eher der Not gehorchend, denn der eigenen Neigung – in eine noch nicht moderne, aber doch nach Modernität strebende Metropole.
Die alten Eliten standen im Abseits, der Adel war abgeschafft. Die republikanische Verfassung war nicht einmal noch beschlossen, da hatten sich die neuen demokratischen Strukturen bereits gefestigt. Ein bis dato unbekanntes Wesen betrat die Szene – es war der neue Mensch, der nun die Phantasien beflügelte, eine Spezies, die nicht einem bestimmten Parteiprogramm entstammte, sondern von der historischen Evolution hervorgebracht wurde, sei es als neuer Mensch des Austromarxisten Max Adler oder als neuer Mensch der Zionisten oder als neuer Lernender der Schulreformer, als neuer Magnat des Börsenfiebers, als Philosoph eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes, als Neutöner in der Musikwelt oder auch als Konsument der neuen Medien der Massenkommunikation: Boulevardpresse, Radio, Kino, Reklame.
Eingebettet in diese brodelnde Atmosphäre lebte das Wiener Judentum. Es war nicht weniger gespalten und fraktioniert wie der Rest der Bevölkerung. Es war in Teilen fromm und treu der Tradition, es lebte in Teilen gottesfern und dem Erbe der Väter entfremdet. Es gab sich teils staatstragend und teils aufrührerisch. Es gab also gottesfürchtige und atheistische Juden wie auch solche, die ihre Abstammung als Verpflichtung oder andere, die sie als Fluch empfanden.
Von dem in Berlin geborenen Historiker und Freud-Biografen Peter Gay stammt die Definition, der zufolge es drei Ursachen dafür gibt, dass ein Mensch der spezifischen Untergruppe Jude zugerechnet wird: Abstammung, Konversion und staatlicher Eingriff, wozu auch gesellschaftliche Willkürakte zu zählen sind. Vor allem die Naziverbrechen und der sie vorbereitende Prozess einer rassistischen Aussonderung sind heute dafür verantwortlich, dass in der historischen Betrachtung nach wie vor die dritte Variante als bestimmender Faktor angesehen wird oder werden muss. Das heißt, es tritt im zeitgeschichtlichen Diskurs die durchaus problematische Zwangsläufigkeit ein, dass eine historische Persönlichkeit nicht jenen Kriterien zufolge in das
soziale Koordinatensystem eingeordnet wird, deren Gültigkeit sie für sich selbst anerkannt hat, sondern danach, welches Etikett sie zugeteilt bekam, gleichgültig, ob sie diese Etikettierung akzeptiert hat und – was schwerer wiegt – obschon wir heute die Kriterien, nach denen diese Etikettierung erfolgte, als bestenfalls menschenrechtswidrig werten. Mit anderen Worten: Wir sehen uns gezwungen, ein rassistisches Regelwerk fortzuschreiben, das wir einerseits ablehnen, dem wir andererseits aber auch nicht zu entkommen wissen.
Gewiss, die Taktik, verhasste oder schlicht verstörende Ideen und Personen mit dem Begriff jüdisch zu denunzieren, war keine originäre Nazi-Erfindung, sondern griff bloß eine alte antisemitische Praxis auf. In Wien ist der Antisemitismus ein soziales Phänomen mit langer Tradition und er kennt viele Schattierungen: von der milden Verachtung bis hin zum mörderischen Hass. Er hat viele Metamorphosen durchgemacht und war, lange bevor die Nationalsozialisten sich seiner bemächtigten, zu einem scheinbar autochtonen Lebensgefühl geworden, das die Emanzipation der Wiener Juden begleitete: Neid, Missgunst, tatsächlich rassistische Überzeugung oder einfach bloß althergebrachte Ressentiments mischten sich zu einem allgegenwärtigen Amalgam, das sich in Wutausbrüchen Luft machte, andernfalls zum Schutz des sozialen Territoriums eingesetzt wurde oder gezielt als politische Waffe diente. Der Antisemitismus war ein Schatten, der den Juden in Wien überallhin folgte und sich nicht abschütteln ließ.
Die Vorstellung, Wien könnte, so wie es Hugo Bettauer in seinem sarkastischen Boulevardroman "Die Stadt ohne Juden" geschildert hatte, über Nacht zu einer Stadt ohne Juden werden, war im Erscheinungsjahr des Bestsellers eine weniger gespenstische denn aberwitzige Vision. Damals lebten laut der Volkszählung von 1923 genau 201.513 Juden in Wien (in ganz Österreich waren es 220.208). In ihrem Tätigkeitsbericht für die Jahre 1933-36 listet die Israelitische Kultusgemeinde 95 Synagogen mit insgesamt 29.200 Sitzplätzen in Wien auf.
Es wurden 47 private Bethausvereine unterstützt, an 83 Volksschulen, 58 Hauptschulen und 55 Mittelschulen erhielten knapp 20.000 Schüler jüdischen Religionsunterricht. 24 Talmud-Schulen, sieben wissenschaftliche Institutionen, acht Studentenvereine, elf Sportvereine, 29 Jugendorganisationen sowie mannigfache soziale, kulturelle und pädagogische Institutionen (von der Koch- und Gartenbauschule oder dem Jüdischen Schauspielerverein über Kindergärten und Schulen, bis zum Altersheim, Krankenhaus, Waisenhaus, Blindenheim und zum Kindererholungsheim in Payerbach-Küb) wurden subventioniert.
Der Anteil der Juden – jener, die in der Israelitischen Kultusgemeinde organisiert waren - an der Gesamtbevölkerung war mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges rasant angestiegen und lag im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende bei 10,8 Prozent (im Wien des Fin de Siècle waren es erst rund acht Prozent gewesen; vierzig Jahre davor zählte die Wiener Jüdische Gemeinde noch weniger als zehntausend Mitglieder). Nach Warschau beheimatete Wien nun die zu diesem Zeitpunkt größte und insgesamt wahrscheinlich bedeutendste Jüdische Gemeinde Europas.
Viele Stetl-Juden, mittellose Flüchtlinge aus den verloren gegangenen Ostprovinzen der zerschlagenen Monarchie, waren in die Stadt geströmt und hatten die ansässigen Juden um ein Element archaischen Judentums bereichert. Sie gesellten sich zu Handwerkern, Händlern, Intellektuellen, Künstlern, Anwälten, Ärzten, Geschäftemachern und saturierten Bürgern. Diese divergente jüdische Bevölkerungsgruppe hatte sich schnell in allen sozialen und kulturellen Schichten ausgebreitet: von den Elendsquartieren des Lumpenproletariats bis zu den Ringstraßenpalais des Großbürgertums.
Sie waren Hungerleider und Wohltäter, Mäzene und Schmarotzer, Spekulanten und Betrogene, Schöngeister und grobschlächtige Schaumschläger, Dichter, Maler und Komponisten, politische Rebellen, Sozialreformer und intellektuelle Aufrührer, fromme Weise und kühne Gelehrte. Sie alle prägten das Erscheinungsbild der Stadt, die für kurze Zeit zu dem europäischen Zentrum der Diaspora, zu einem verklärten Hoffnungsschimmer für Zufluchtssuchende und zu einer Hochburg frommer Gelehrsamkeit geworden war.
Der verbreiteten Auffassung einer plötzlichen intellektuellen und künstlerischen Explosion steht die Hypothese gegenüber, die wahrscheinlich bedeutendste Kulturleistung des vergangenen Jahrhunderts, die Entdeckung des modernen Weltbildes, verdankt sich nicht so sehr der gegenseitigen Befruchtung, sondern viel eher ihrem Gegenteil: Sie war das Produkt junger, jüdischer Zuwanderer, die eine Gegenwelt zu dem eingesessenen Wiener Establishment entwarfen.
Weil die Wiener nicht Platz machen wollten, schufen sie genau das, was sie zu verhindern suchten: die geistige und kulturelle Erneuerung. Dieser Prozess setzte sich zu Beginn der Ersten Republik fort. Neuerlich stießen Zuwanderer, diesmal sind es die Flüchtlingsströme galizischer Juden, auf offene und unverhohlene Ablehnung – sowohl unter der jüdischen Bevölkerung selbst, die sich von der ärmlichen und orthodoxen Ghetto-Mentalität in ihrem Selbstverständnis bedroht sah wie auch unter den übrigen Wienern, die bis hin zum Ausbruch von Epidemien alles Erdenkliche befürchteten.
Assistenz: Naomi Kalwil
Das Ausstellungsteam, der Katalog
Kurator: Joachim Riedl, Mitarbeit: Niko Wahl, Architektur: Gustav Pichelmann, Grafik: José Coll, Organisation: Gerhard Milchram, Assistenz: Naomi Kalwil. Zur Ausstellung erscheint ein begleitender Text- und Bildband im Zsolnay-Verlag, hrsg. von Joachim Riedl mit Beiträgen von (u.a.) Friedrich Achleitner, Clemens Jabloner, Michael Häupl, Peter Huemer, Edward Timms und Wolfgang Maderthaner, mit 396 Seiten und über 400 zum Teil farbigen Abbildungen. Erhältlich im Museum zum Preis von ca. 26,90 Euro (ISBN-Nr. 3-552-05323-9) und im Buchhandel zum Preis von ca. 34,90 Euro (ISBN-Nr. 3-552-05315-8).